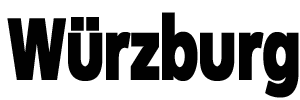Uniklinikum Würzburg: 1.000 Nierentransplantationen in 30 Jahren

Das Nierentransplantationsprogramm am Universitätsklinikum Würzburg erlebt in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum: Zum einen wurde im Dezember 1984 also vor ziemlich genau 30 Jahren die erste Niere dieses Standorts verpflanzt. Und zum anderen überschritten die Würzburger Spezialisten schon im Mai 2014 die einprägsame Marke von insgesamt 1.000 Nierentransplantationen.
In den letzten Jahren werden am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) jährlich im Schnitt 30 bis 40 Nieren transplantiert. Schon seit drei Jahrzehnten zählt der komplexe Eingriff, der die Lebenserwartung und die Lebensqualität vieler Patienten deutlich erhöht, zum Leistungsportfolio des mainfränkischen Krankenhauses der Maximalversorgung. Im Mai dieses Jahres fand die insgesamt tausendste Verpflanzung des lebenswichtigen Organs statt.
Der Patient als Person im Mittelpunkt
Im deutschlandweiten Vergleich zählt das Nierentransplantationsprogramm des UKW zu den mittelgroßen Zentren. „Mit unserer schlanken, persönlich geprägten Struktur ist es unser Anspruch, jeden Patienten so individuell und familiär wie nur möglich zu versorgen“, betont Privat-Dozent Dr. Kai Lopau, der zusammen mit seinen urologischen Kollegen unter Prof. Hubertus Riedmiller das Würzburger Nierentransplantationsprogramm leitet.
Transplantate auch für ältere Menschen
Seit im Dezember 1984 unter dem Nephrologen Prof. Ekkehart Heidbreder und dem Urologen Prof. Hubert Frohmüller die erste Nierentransplantation am Würzburger Uniklinikum durchgeführt wurde, hat sich vieles verändert. „War früher der Zugang zur Warteliste für ein Spenderorgan stark limitiert, wurde er zwischenzeitlich deutlich geöffnet“, berichtet Dr. Lopau. Der Oberarzt der Abteilung Nephrologie der Medizinische Klinik I fährt fort: „Heute können auch ältere Menschen eine neue Niere erhalten und so von der Dialyse wegkommen unser Altersrekord liegt bei 74 Jahren. In den Anfangsjahren war dieses Angebot auf Patienten unter 50 Jahren beschränkt.“
Diese aus humanitären Gesichtspunkten sehr zu begrüßende Entwicklung wirft aber auch Probleme auf: Je älter die Nierenempfänger werden, umso mehr Begleiterkrankungen müssen die Mediziner im Blick behalten. Parallel dazu steigt bei älteren Patienten das Risiko von Komplikationen und Nebenwirkungen. Um auch für diese Zielgruppe die Erfolgsaussichten hoch zu halten, hat sich die Transplantationsmedizin in den vergangenen Jahren ständig weiterentwickelt. Dr. Lopau: „Uns stehen heute zum Beispiel wesentlich schonendere Medikamente zur Verfügung, die wir in geringeren, weniger belastenden Dosierungen verabreichen können.“
Spender werden immer älter
Nicht nur das Durchschnittsalter der Organempfänger stieg in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch das Alter der gespendeten Organe. Die Menschen in Wohlstandsnationen wie Deutschland und damit auch die potenziellen Organspender werden später krank und leben länger. Immer weniger junge Menschen sterben vorzeitig. „Die Nierenfunktion eines 35-Jährigen, der bei einem Autounfall getötet wurde, ist sicher deutlich besser, als die eines 65-Jährigen, der an einem Schlaganfall gestorben ist“, bringt Dr. Lopau die damit verbundene Problematik auf den Punkt. Auch hier habe sich die Medizin angepasst und den Umgang speziell mit älteren Organen vor, während und nach der Transplantation verbessert, zum Beispiel durch eine genauere Kühlung.
Es fehlt an Vertrauen
Als besonders tiefgreifende und bedauernswerte Veränderung zwischen 1984 und heute sieht Dr. Lopau den allgemeinen Vertrauensverlust in die Transplantationsmedizin. „Zu Beginn war das Vertrauen in die Organspende gerade hier Unterfranken sehr hoch. Aber schon in den 1990er Jahren führten gesetzliche Unsicherheiten zu einem ersten Vertrauensverlust“, berichtet der Oberarzt. Besonders verheerend habe sich dann der Transplantationsskandal an einer Reihe von anderen deutschen Einrichtungen im Jahr 2012 ausgewirkt. Als Indiz dafür, dass das Vertrauen auf verschiedenen Ebenen in der Öffentlichkeit stark gestört ist, wertet Dr. Lopau unter anderem das offenbar schwindende Interesse von Dialysepatienten an einem Spenderorgan: „Im Moment haben wir am UKW 250 Patienten auf der Warteliste, weniger Patienten werden zur Abklärung der Transplantations-Eignung von ihren Nierenärzten vorgestellt.“
Übergreifendes Transplantationszentrum im Aufbau
Eine Maßnahme, um wieder Vertrauen aufzubauen, ist das Schaffen von noch transparenteren und noch effizienteren Strukturen. Das Universitätsklinikum Würzburg arbeitet dazu derzeit an der Umstrukturierung des Transplantationszentrums. Dieses soll als Dachstruktur die verschiedenen Transplantationsprogramme für Niere, Herz, Leber und Pankreas bündeln und Anfang 2015 seine Arbeit aufnehmen. „Zwar bleiben alle Programme nach wie vor autark, sie sollen jedoch einen gemeinsamen Außenauftritt erhalten“, beschreibt Prof. Ingo Klein von der Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des UKW. Der Leiter der Transplantationschirurgie des Leberzentrums ist zusammen mit Dr. Lopau der Sprecher des Zentrums. In der neuen Struktur wird es einen monatlichen Transplantationsrat geben eine Konferenz, in der sich die Experten der einzelnen Programme austauschen. „Viele Aufgaben und Herausforderungen bei der Transplantation unterschiedlicher Organ ähneln sich, wie zum Beispiel die Behandlung und das Screening von Infektionen, die Behandlung von Nebenwirkungen oder die Immunsuppression“, sagt Prof. Klein. „Hier können wir in engem Austausch gemeinsame Richtlinien und Standards erarbeiten.“ Außerdem soll das Zentrum dazu genutzt werden, weitere Aufklärungsarbeit zum Thema Organspende zu leisten. Neben den Sprechern wird ein geschäftsführender Arzt die Anliegen der Transplantationsmedizin am UKW nach innen und nach außen vertreten.
Foto: Experten des Nierentransplantationsprogramms des Uniklinikums Würzburg mit einem der kürzlich erfolgreich transplantierten Patienten. Von links: Prof. Christoph Wanner (Nephrologie), Prof. Hubertus Riedmiller (Urologie), Patient Bernd Estenfelder, Prof. em. Ekkehart Heidbreder (ehem. Nephrologie) sowie PD Dr. Kai Lopau (Nephrologie).